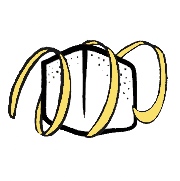Oft schon haben wir uns gefragt was ist eigentlich der Unterschied zwischen V(W)Wodka und Korn? Und was ist eigentlich dran an dem Spruch: “Korn ist der bessere Vodka”? Deswegen haben wir uns mit beiden Spirituosen auf der technischen Seite und den Verordnungen auseinander gesetzt.
Die Unterschiede per Gesetz
Die beiden Spirituosen Korn und Vodka teilen eine gemeinsame biochemische Grundlage, unterscheiden sich jedoch in ihrer aromatischen Zielsetzung und ihrer Herstellungsweise. Beide entstehen durch die Vergärung stärkehaltiger Rohstoffe, die anschließend destilliert werden, um Ethanol zu gewinnen. Doch während Korn als regionale, getreidegeprägte Spirituose bewusst den Rohstoffcharakter betont, strebt Vodka technisch nach größtmöglicher Neutralität. Diese beiden Pole prägen nicht nur das sensorische Ergebnis, sondern auch das rechtliche und kulturelle Selbstverständnis beider Kategorien.
Die Verordnung (EU) 2019/787 definiert Vodka als Spirituose aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, gewonnen aus Getreide oder Kartoffeln, wobei auch andere Rohstoffe erlaubt sind, wenn ihre Herkunft angegeben wird. Der Alkohol muss hochrektifiziert sein, und eine Aktivkohlebehandlung ist zulässig, um Begleitstoffe zu entfernen. Süßung ist bis zu acht Gramm pro Liter erlaubt, Färbung verboten. Die Abfüllung muss mit mindestens 37,5% erfolgen. Zusätzlich darf Vodka mit natürlichen oder auch künstlichen Geschmacksstoffen aromatisiert werden, wie die Flavoured Linie von Absolut Vodka eindrucksvoll zeigt.
Korn dagegen ist eine streng definierte Getreidespirituose, die ausschließlich aus vollem Korn (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Buchweizen) destilliert werden darf. In Deutschland darf Korn ab 32 Vol.-%, Kornbrand ab 37,5 Vol.-% in den Verkehr gebracht werden, eine Süßung ist nur geringfügig zur geschmacklichen Abrundung gestattet.
Historische Entwicklung und regionale Identität
Historisch entstand der Kornbrand im 15. Jahrhundert in Norddeutschland aus der Praxis der Bierbrenner, die überschüssige Würze destillierten. Schon früh entwickelte sich daraus eine eigenständige Brenntradition, besonders im Münsterland, in Westfalen und in Niedersachsen. Der Korn war kein Luxusgut, sondern Ausdruck bäuerlicher Selbstversorgung. In Regionen wie Sendenhorst oder dem Münsterland etablierte sich ein regionaltypischer Brennstil, der in den heutigen EU-Geschützten Angaben weiter besteht.
Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Vodka im Osten Europas. In Polen und Russland bezeichnete der Begriff „wódka“ zunächst jedes Destillat, erst im 19. Jahrhundert, mit der Erfindung der Rektifikationskolonne, entstand der heutige, neutrale Vodka-Typus. Die technischen Möglichkeiten der Kolonnendestillation erlaubten es erstmals, Ethanol nahezu rein zu konzentrieren, wodurch der Geschmack weitgehend von Rohstoffaromen befreit werden konnte. Dieses Ideal der Reinheit prägte Vodka als nationales Symbol, zunächst in Russland und Polen, später als globales Konsumprodukt.
Rohstoffe und biochemische Grundlagen
Die Rohstoffe bilden den Kern des Unterschieds. Korn darf ausschließlich aus Getreide hergestellt werden, während Vodka breiter definiert ist und neben Getreide und Kartoffeln auch Trauben, Zuckerrüben, Erbsen oder auch Molke (ja, klingt abgefahren) umfassen kann. In der Praxis beeinflussen diese Unterschiede die Fermentation.

Für die Herstellung neutraler Spirituosen, wie sie für Vodka typisch sind, dauert die Gärung meist zwischen 48 und 96 Stunden. Verwendet werden hochalkoholtolerante Hefestämme wie Saccharomyces cerevisiae, die bei kontrollierter Temperatur und pH-Führung arbeiten, um Nebenprodukte zu minimieren. Neuere Studien (u. a. Black & Walker 2023) beschreiben den gezielten Einsatz von Nährstoffen, Sauerstoffmanagement und „High-Gravity“-Würzen zur Maximierung der Ethanolbildung bei gleichzeitiger Minimierung flüchtiger Kongeneren.
Für Korn ist der Ansatz ein anderer. Hier liegen die Fermentationszeiten bei zwei bis sechs Tagen. Die längere Gärung erzeugt bewusst mehr Vorläuferstoffe wie Aldehyde, Ester und höhere Alkohole, die später das getreidige Aroma stützen. In beiden Fällen werden die Maischen vollständig vergoren, ehe sie der Destillation zugeführt werden.
Destillationstechnik und Nachbehandlung
Korn wird traditionell in diskontinuierlichen Brennblasen oder einfachen Kolonnensystemen destilliert, meist zweifach. Durch die gezielte Schnittführung zwischen Vor-, Mittel- und Nachlauf bleibt ein Teil der aromatragenden Kongeneren, wie zum Beispiel Furfural, Pyrazine oder Isoamylalkohol, die für den brotigen, malzigen Eindruck sorgen, enthalten. Diese bewusste Unvollkommenheit verleiht Korn seine milde, aber aromatisch charakteristische Note.

Vodka hingegen wird fast ausschließlich in großtechnischen, mehrstufigen Kolonnen destilliert, oft mit über sechzig Böden (oder auch Platten). Das Ergebnis ist ein Alkohol von rund 96 Vol.-%, also nahe dem reinen Maximum. Anschließend erfolgt das sogenannte „Polishing“ über Aktivkohle. Die Kohlen variieren in Porengröße und Oberflächenchemie, sie adsorbieren polare und unpolare Spurstoffe – Aldehyde, Fuselöle, kurzkettige Ester – und reduzieren so Geruchs- und Geschmacksnoten auf ein Minimum. GC-MS-Analysen (Gaschromatographie-Massenspektrometrie) belegen, dass selbst nach dieser Reinigung minimale Mengen an Verbindungen wie Ethylacetat oder Isoamylalkohol zurückbleiben, die für subtile Unterschiede zwischen den unterschiedlich Marken verantwortlich sind.
Sensorik und Aromatik
Sensorisch liegt der Unterschied damit klar auf der Hand. Korn duftet nach Brot, Getreide, malzigen und nussigen Anklängen, je nach Rohstoff und Reifegrad. Weizen ergibt mildere, süßliche Brände, Roggen liefert würzigere, erdigere Noten. Vodka dagegen ist geruchlich und geschmacklich weitgehend neutral, allenfalls mit feinen Unterschieden durch Rohstoff oder Wasser. In analytischen Tests bleiben zwar Unterschiede messbar, doch sensorisch dominieren Reinheit, Milde und Textur.
Reifung und Lagerung
Die Reifung bildet einen weiteren Gegensatz. Vodka wird nicht gelagert, da jede Holz- oder Farbtönung rechtlich unzulässig wäre. Korn hingegen kann, und darf, reifen. Nach den nationalen Kodizes und GI-Regeln genügt ein halbes Jahr Holzkontakt, um die Bezeichnung „holzfassgereift“ zu tragen. Diese Lagerung, meist in Eichenfässern, bringt Vanillin, Laktone und leichte Karamellnoten ein. Gereifte Kornbrände wie der „Lagerkorn“ aus dem Münsterland zeigen, wie nah Korn qualitativ an gereifte Getreidedestillate wie Whisk(e)y heranreichen kann, jedoch ohne deren Torf- oder Fassintensität.
Moderne Produzenten und Innovationsachsen
Die Moderne hat beide Kategorien weiterentwickelt. Bei Vodka treten zunehmend Produzenten hervor, die die Grenze zwischen Neutralität und Ausdruck ausloten. In Polen interpretiert Vestal das Produkt terroirgeprägt. Kartoffel-Sorten wie Asterix oder Innovator werden separat destilliert, die Abfüllungen tragen Jahrgangsbezeichnungen. Belvedere Single Estate Rye folgt einem ähnlichen Ansatz, nutzt jedoch Roggen aus zwei geographisch kontrastierenden Regionen (Lake Bartężek und Smogóry Forest) und betont deren klimatische und sensorische Unterschiede. In Island verwendet Reyka Vodka geothermische Energie und filtriert durch poröses Lavagestein. Arbikie Nàdar Vodka aus Schottland geht noch weiter: Er wird aus Erbsen gewonnen, bindet atmosphärisches CO₂ und gilt laut Lebenszyklusanalysen als „climate positive“. Black Cow Vodka in England wiederum nutzt Molke aus der Käseproduktion, um Lebensmittelnebenströme zu verwerten. In Finnland arbeitet Koskenkorva nahezu vollständig mit erneuerbarer Energie und verwertet Gerstenhülsen als Brennstoff. Die Brennerei will bis 2026 fossilfrei produzieren. Cîroc Vodka aus Frankreich zeigt, dass auch Trauben als Basis dienen können, wobei die EU-Verordnung in diesem Fall die Herkunftsangabe „produced from grapes“ verlangt.

Auch der Korn erlebt Innovationen. Marken wie NORK positionieren ihn als modernen, milden, aber nicht neutralen Doppelkorn aus 100 % Weizen, destilliert in Kooperation mit der Sasse Feinbrennerei. Der „Lagerkorn“ aus eben jener Brennerei demonstriert Premiumisierung durch lange Holzreife durch V.S.O.P.-Qualitäten bis 15 Jahre. Kleinere Betriebe wie die Heimat Distillers bringen regionale Korn-Interpretationen in die Barszene und positionieren die Spirituose jenseits des Klischees vom „Kurzen“.
Märkte und Volumen
Weltweit bleibt Vodka die volumenstärkste Spirituosenkategorie. Laut Daten von IWSR, DISCUS und The Spirits Business wurden 2024 rund 74 Millionen 9-Liter-Kisten Vodka verkauft. Globaler Marktführer ist Smirnoff (Diageo) mit etwa 24 Millionen Kisten, gefolgt von Absolut (Pernod Ricard) mit über 12 Millionen Kisten. In den USA dominiert Tito’s Handmade Vodka, ebenfalls mit über 12 Millionen Kisten, obwohl die Kategorie dort leicht rückläufig ist (–1 % Volumen 2024).

Gleichzeitig wachsen Premium- und Nachhaltigkeitssegmente sowie Ready-to-Drink-Produkte auf Vodka-Basis. In Deutschland zeigt sich ein anderes Bild. Der Gesamtspirituosenmarkt war 2024 um 2,4 % rückläufig, doch Marken wie Echter Nordhäuser behaupteten sich stabil. Der Trend geht zu höherwertigen, authentischen Produkten.
Zusammenfassung
Technologisch lässt sich der Unterschied zwischen Korn und Vodka in drei Punkten zusammenfassen. Erstens: Die Destillationstechnik. Korn nutzt bewusst niedrigere Rektifikationsgrade, um Aromen zu bewahren; Vodka setzt auf maximale Fraktionierung und Adsorption. Zweitens: Die Fermentation. Vodka-Vorstufen werden kurz und heiß vergoren, um Kongenere zu vermeiden, Korn länger und ruhiger, um sie zu fördern. Drittens: Die Rohstoffbasis. Vodka ist flexibler, Korn strikt an Getreide gebunden.
Damit steht Korn für Ausdruck, Vodka für die Reduktion, doch die Grenze verwischt. Vodka-Produzenten entdecken Herkunft, Nachhaltigkeit und Textur als Differenzierungsmerkmale, während Korn durch Premiumisierung und Fassreife an Tiefe gewinnt.
Moderne Produzenten wie Vestal, NORK, Belvedere, Reyka, Arbikie, Black Cow und Koskenkorva illustrieren, dass sowohl Neutralität als auch Herkunft in der zeitgenössischen Brennkunst ihren Platz haben. So stehen Korn und Vodka heute nicht mehr für Gegensätze, sondern für zwei unterschiedliche Wege, das Wesen des Getreides zu destillieren
Cheers!