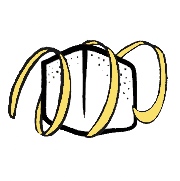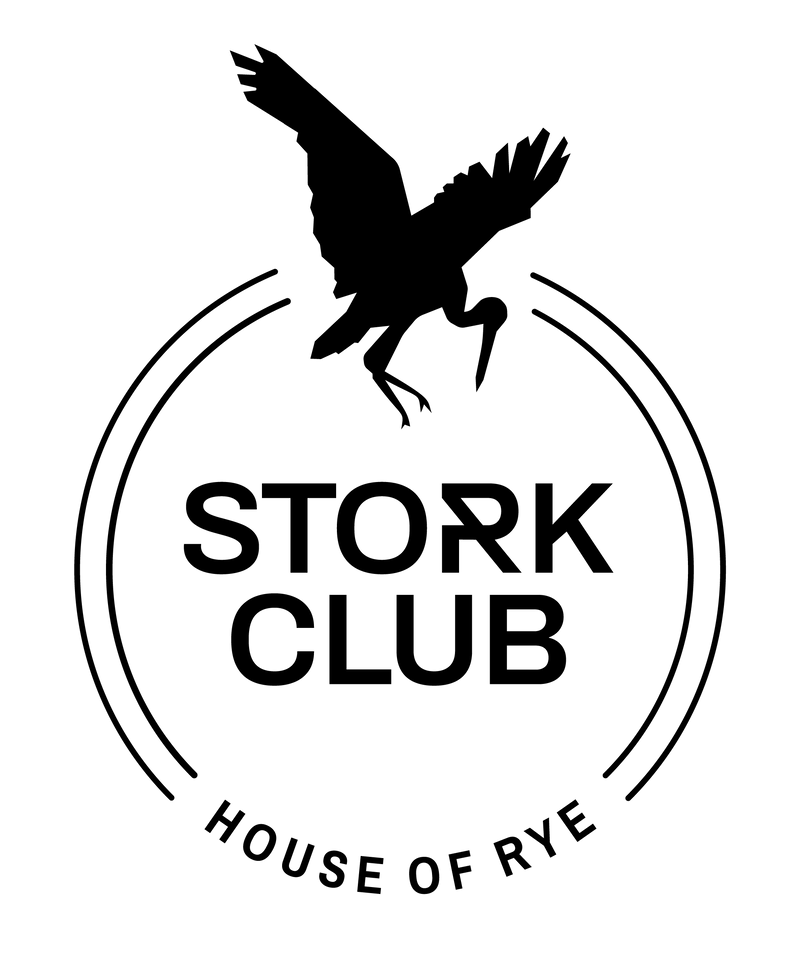Wir waren zu einem spannenden Blending-Workshop ins “House of Rye” in Berlin eingeladen. Gastgeber waren an diesem Nachmittag die bestens gelaunten Steffen Lohr (Gründer von Stork Club) und Jörn Gohlke von Reidemeister & Ulrichs. Der Workshop begann mit der Geschichte wie sich die drei Gründer kennenlernten, die Brennerei erworben und modernisiert haben und wie der Whiskey überhaupt hergestellt wird.



Die Geschichte von Steffen Löhr, Sebastian Brack und Bastian Heuser – erzählt von Steffen Löhr
Die beiden Gründer Steffen Lohr aus Frankfurt und Bastian Heuser aus Köln lernten sich im Umfeld der Frankfurter Barszene kennen, die damals zu den kreativsten und lebendigsten in Deutschland gehörte. Steffen arbeitete zu diesem Zeitpunkt seit ca. 10 Jahren in der Gastronomie, er arbeitete unter dem italienischen Bartender Davide De Marci, einer festen Institution der Frankfurter Barkultur. Schon damals wurden in der Bar Drinks auf heutigem Niveau produziert. Ein Novum zur damaligen Zeit.
Bastian stieß später dazu und brachte ein “frisches Mindset” mit, geprägt von seiner Zeit in London, geprägt von modernen Barstrukturen. Während die Frankfurter Szene für Steffen inzwischen Alltag war, erkannte er in Bastians Zugang neue Impulse. Gemeinsam entwickelten sie das Konzept der Biancalani weiter, werteten die Bar auf und steigerten das Niveau so weit, dass sie sogar an großen gastronomischen Wettbewerben erfolgreich teilnahmen.
Bastian zog später nach Berlin, engagierte sich dort in der Szene und war unter anderem in die Entwicklung des Bar Convent Berlin involviert. Trotz räumlicher Distanz blieb die Verbindung der beiden bestehen, freundschaftlich wie beruflich. Steffen arbeitete zwischenzeitlich in einer der besten Bars der Welt „Der Raum“ in Melbourne und später 5 Jahre als Brand Ambassador für eine sehr große Rum-Marke, eine prägende Phase in seinem Leben. Viel Reisen, kreative Freiheit und die Möglichkeit, die internationale Barwelt intensiv kennenzulernen.
Mit den Jahren wandelten sich jedoch die Lebensumstände. Familien wurden gegründet, Prioritäten verschoben sich. Steffen und Bastian beschlossen deshalb, gemeinsam mit Sebastian Brack (er erfand die Marke “Thomas Henry” und ist Mitbegründer von “Belsazar Vermouth”) die Agentur “Small Big Brands” ins Leben zu rufen. Zunächst ohne klaren Fokus. Die Idee umfasste ein breites Spektrum. Events, Promotion, Produktentwicklung, Markenberatung und alles, was sie aufgrund ihres Netzwerks und ihrer Expertise bedienen konnten. Das Konzept funktionierte. Die Agentur wuchs schnell, beschäftigte bald bis zu 10 Mitarbeitende und betreute namhafte Kunden. Unter anderem waren sie an der Entwicklung eines Dry Tonics beteiligt.
Doch mit dem Wachstum kamen neue Schwierigkeiten. Die Budgets wurden kleiner, die Projekte komplexer, die Kunden anspruchsvoller. Steffen erkannte, dass ein grundlegender Richtungswechsel notwendig war. Alle drei wollten weg aus der Rolle der Dienstleister, hin zu einem eigenen Produkt.
Die Idee eines eigenen Destillats entstand aus der Erfahrung, das es faktisch in Deutschland kaum Rye Whiskey gab, obwohl die Rohstoffbasis ideal war. Sie sahen einen unbesetzten Markt und ein großes Potenzial für ein eigenständiges, authentisches Produkt.
Die Gründung von Stork Club Whiskey
Bastian und Sebastian fuhren zu einer Brennerei um volle Whiskey-Fässer zu kaufen, was nicht klappte, da die Brennerei ihren Whiskey selbst benötigte. Aber von dort kam der entscheidende Hinweis: In Schlepzig im Spreewald stand eine ganze Destillerie zum Verkauf. Also fuhren sie dorthin. Sie fanden eine wunderschöne Destillerie vor mit allem was dazu gehört.
Wir waren “schockverliebt”, wie es Steffen erzählte. Sie wussten sofort, dass genau hier ihr Projekt beginnen musste. „Wir wussten nicht, was wir tun, nicht, was es kostet, nicht, wie das Produkt am Ende schmeckt – aber wir wussten, dass wir es machen müssen“, erinnert sich Steffen. Die Stork Club Brennerei stellte zuvor bereits seit 2012 Whiskey vor Ort her, der auch bereits in Jim Murray`s Whisky Bible mit 94 Punkten ausgezeichnet wurde (Sloupisti Whisky).
Die Verhandlungen dauerten lange. Doch irgendwann zeichnete sich ab, dass der Kauf realisierbar war. Etwa 200 Fässer standen zur Übernahme im Raum. Sie erarbeiteten einen Businessplan und gingen zur ihrer damaligen Hausbank. Dort wurden sie sofort abgelehnt, also zogen sie zur nächsten Bank weiter.
Dieser Termin verlief “überraschend entspannt, mit Cappuccino”, wie sich Steffen erinnert. Das Gespräch dauerte 45 Minuten. Am Ende hieß es: „Wir melden uns.“ Niemand rechnete mit einer Antwort, doch drei Tage später kam der Anruf, dass die Bank das Projekt finanziert. Für Steffen war es der Moment, an dem aus einer Idee plötzlich Realität wurde.
Dann folgte der tatsächliche Erwerb und Umbau der Destillerie in Schlepzig. Im Oktober 2016 erhielten sie schließlich das offizielle Schlussdokument, das ihnen den Zugang zur Anlage und den gesamten Bestand sicherte. Damit war der rechtliche Grundstein gelegt, doch der technische Teil stand erst am Anfang.
Die Anlage in Schlepzig war zwar funktionstüchtig, aber nicht für die Herstellung eines hochwertigen Rye Whiskeys ausgelegt. Die Infrastruktur für eine professionelle Maischeführung fehlte ebenso wie moderne Steuertechnik und ein effizientes Destillationssystem. Deshalb investierten die Gründer noch einmal rund eine halbe Million Euro, um Gärtanks, Leitungen, Steuerzentralen und Brenntechnik komplett neu aufzubauen. Dieser Umbau war notwendig, um die Produktion nicht nur möglich, sondern auch qualitativ konkurrenzfähig zu machen.

Alle laufen rechts – also schauen wir mal was links so passiert
Da Steffen und Bastian zwar aus der Gastronomie kamen, aber keine Destillateure waren, standen sie vor der Herausforderung, sich das technische Wissen weitgehend selbst anzueignen. Kurse, die eigentlich zur Vorbereitung auf den Destillationsmeister dienen sollten, halfen ihnen nur bedingt, denn sie waren theoretisch, abstrakt und inhaltlich kaum auf die Praxis übertragbar. Doch im Laufe der Zeit begegneten sie Menschen, die entscheidend zur Entwicklung der Destillerie beitrugen.
Eine zentrale Rolle spielte Johannes Anleitner (Anleitner Brennerei in Bad Kötzting), ein erfahrener Brenner aus der traditionellen Obstbrand-Szene. Er war einer der wenigen, die bereit waren, ihr Wissen offen weiterzugeben. Er erklärte Steffen nicht nur die Grundlagen, sondern auch die physikalischen und sicherheitsrelevanten Aspekte der Destillation. Ebenso wichtig war Richard Hodges (Braumeister). Unter seiner Anleitung lernten die Gründer, wie man Fermentation, Temperaturführung und alkoholische Ausbeute optimal steuert.
Ein Leitmotiv des gesamten Projekts war stets der Wunsch, anders zu arbeiten als der Rest der deutschen Whiskeyszene. Steffen beschreibt es so:
„Alle laufen rechts – also schauen wir mal was links so passiert.“
Auf diese Weise entwickelte sich Stork Club Whiskey bewusst gegen den Trend der Single-Malt-Orientierung und etablierte stattdessen einen eigenständigen, deutschen Rye-Stil. Heute ist die Marke Synonym für deutschen Rye Whiskey und gilt als eines der ambitioniertesten Projekte der modernen deutschen Brennereiszene. Seid 2022 ist die Brennerei sogar Bio-zertifiziert.

Wie wird der Whiskey hergestellt?
Der Roggen
Für Stork Club ist entscheidend, dass der Roggencharakter nicht durch übermäßige Malzzugabe überlagert wird. “Bereits ab etwa 30–40 % Malzanteil verschiebt sich das Aromaprofil deutlich in Richtung Malz, ein Effekt, der bei einem reinen Rye-Stil unerwünscht ist” sagt Steffen. Daher unterscheidet die Destillerie bewusst zwischen Roggen-Rohfrucht und Roggenmalz Destillat, um die sensorische Integrität der Getreidesorte zu bewahren.

Im Workshop erzählt er vom sogenannten „John Doe des Roggens“. Dem Condukt-Roggen. Ein neutraler, sortentypischer Roggen: “robust, klar in der Struktur und ohne übermäßige Malznoten”. Der benötigte Roggen wächst in der Umgebung der Brennerei (ca. 15km). Für die Vergärung setzt Stork Club auf die Belle Saison-Hefe (oft auch „Belgian Saison Yeast“ genannt), um ein besonders fruchtiges Destillat zu erhalten. Der Fermentationsprozess dauert fünf Tage.
Die Destillation
Während viele deutsche Produzenten mit kleinen Pot Stills arbeiteten, entschieden sich Stork Club bewusst für eine moderne Hybridbrennalage, ein leistungsfähiger Pot-Still mit angeschlossener Säule (Aromator mit 5 Glockenböden (Kothe 1000 Liter) und 7 Kochböden (Carl 650 Liter). Diese ermöglichte präzise Cuts, reproduzierbare Qualität und klare Aromenkontrolle. Aus 1.000 Litern Maische gewinnen sie ca. 100 Liter Roggendestillat, der bei 75 – 78% liegt und anschließend auf 60% herabgesetzt wird, bevor er ins Fass kommt.

Das Fassmanagement
Die Fasslagerung entwickelte sich zu dem Schwerpunkt der Brennerei. In Schlepzig befinden sich heute rund 1.200 Fässer, darunter amerikanische Weißeiche, europäische Eiche, ehemalige Wein- und Sherryfässer sowie experimentelle Holzvarianten. Ein Großteil der frühen Experimente bestand darin, die Auswirkungen unterschiedlicher Holzarten und Toastings auf den Geschmack des Roggenwhiskeys zu verstehen.

Amerikanische Weißeiche, reich an Lignin, bringt typischerweise süße, vanillige Noten mit sich, während europäische Eiche kantiger, trockener und oftmals rotweinartiger erscheint. Neben der klassischen Eiche wurden auch ungewöhnliche Holzarten wie Walnuss, Esche, Kirsche oder Maulbeer verwendet, die teils interessante, teils problematische Aromen erzeugten. Manche Experimente führten zu sehr speziellen Ergebnissen. Besonders fettreiche Fässer (Walnuss) zum Beispiel oxidieren anders, zeigen kaum sichtbare Flüssigkeit an der Oberfläche und führen zu unerwarteten Geschmacksprofilen. Für die Sherryfassreifung kommen echte Sherryfässer zum Einsatz, keine Seasoned Casks. Die Lagerzeit beträgt mindestens 4,5 Jahre.
Der „Angel’s Share“ bei Stork beträgt 4% pro Jahr. Also gut doppelt soviel wie in Schottland, aber immer noch deutlich weniger wie in Rum-Regionen. Derzeit lagern 1200 Fässer bei Stork.
Im Bereich Fassmanagement wurde deutlich, wie aufwendig der Umgang mit teilweise über 1200 Fässern tatsächlich ist. Alle Fässer müssen wöchentlich kontrolliert werden, andere zeigen aufgrund ihrer Beschaffenheit extreme Verdunstungsraten. Verzögerungen bei Fasslieferanten, Qualitätsprobleme oder schlicht falsche Holzchargen gehören ebenso zum Alltag wie die Entscheidung, problematische Fässer auszuschleusen bzw. umzubelegen.
Danach gab es ein Pause, die mit einer zünftigen Brotzeit mit typischen Spreewälder Leckereien gefüllt wurde. Überhaupt wurde sich ausgezeichnet um das leibliche Wohl gekümmert.
Blending & Tasting
Der White Dog
Als erste Probe landete der White Dog im Glas. Das frisch destillierte Roggendestillat, erst zwei Wochen alt und im Edelstahltank gelagert, wurde für die Verkostung auf 60 % vol. eingestellt. Sensorisch bemerkenswert ist das vollständige Fehlen von Kleber- oder Lacknoten, wie sie bei jungen Destillaten gelegentlich auftreten. Dafür ist das Destillat unwahrscheinlich fruchtig. Diese Fruchtnote hält sich dauerhaft im Glas. Für 60% ist das Destillat erstaunlich mild. Klar man spürt den Alkohol, aber er ist aufgrund der öligen Textur gut trinkbar.



Der Blending-Workshop
Dann kamen wir zum eigentlich Highlight des Nachmittags. Für das Blending des eigenen Whiskeys standen uns vier kleine Fässer zur Verfügung, die jeweils mit einer 60%igen Variante des klassischen Stork Club Straight Whiskey-Blends (80% amerikanische Eiche, 20% europäische Eiche) in vier verschiedenen Fass-Typen für einige Monate nachgereift wurden.



An jedem Fass standen vier nummerierte Becher, um eine spätere Verwechslung auszuschließen. Es standen folgende Fass-Typen zur Auswahl:
- amerikanische Eiche (bourbontypische Lacknoten und süße Vanille)
- europäische Eiche (würzig, kräuterig, tanninhaltig und trocken)
- PX Sherry (süß, fruchtig, traurig mit leichter Würze)
- Ruby Port (dezent süß, Walnuss, würzig)
Jedes Fass wies ein eigenes Aromenspektrum auf, wobei das Grunddestillat und die charakteristische Stork-Club-Note weiterhin präsent blieben. Es folgten Verkostung und ausführliche Notizen. Danach wurde eine Probe pipettiert, erneut bewertet und entsprechend angepasst. Abschließend wurde die finale Mischung auf 200 ml hochgerechnet, dem Volumen der bereitgestellten Flasche.



Mein Blend bestand am Ende aus einem Mix aus 60% europäischer Eiche, 25% Ruby Port und 15% amerikanischer Eiche. Mich hat das würzige Profil am meisten angesprochen, während um mich herum eher süßer geblendet wurde.
Tasting der Abfüllungen
Nach dem Blending bot sich die Gelegenheit, in die Stork-Abfüllungen einzutauchen – sogar einige längst vergriffene Editionen fanden ihren Weg ins Glas. Ich wählte den neuen Cherry sowie die Coffee-Variante. Der Cherry legte im Abgang einen flüchtigen Hauch von roter Grütze frei, doch im Kern dominierte eine klare, saftige Kirschnote. Die Süße war fein dosiert und wirkte perfekt eingebunden.



Die Coffee-Variante war ein Highlight: Der Kaffee war hervorragend eingebunden und hat dem Drink eine tolle Tiefe verliehen – als Kaffeeliebhaber hat mich das natürlich besonders abgeholt, auch wenn nicht alle Teilnehmer gleichermaßen begeistert waren. Der anschließende Premix mit der Peanuts-Special-Edition als Old Fashioned war ein weiterer gelungener Akzent des Abends und hat mir ebenfalls sehr zugesagt.
Ein Nachmittag wie aus einem Guss – exzellente Spirituosen, ein Erzähler, der Geschichten zum Leben erweckt, und eine Runde von Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt.
Cheers!